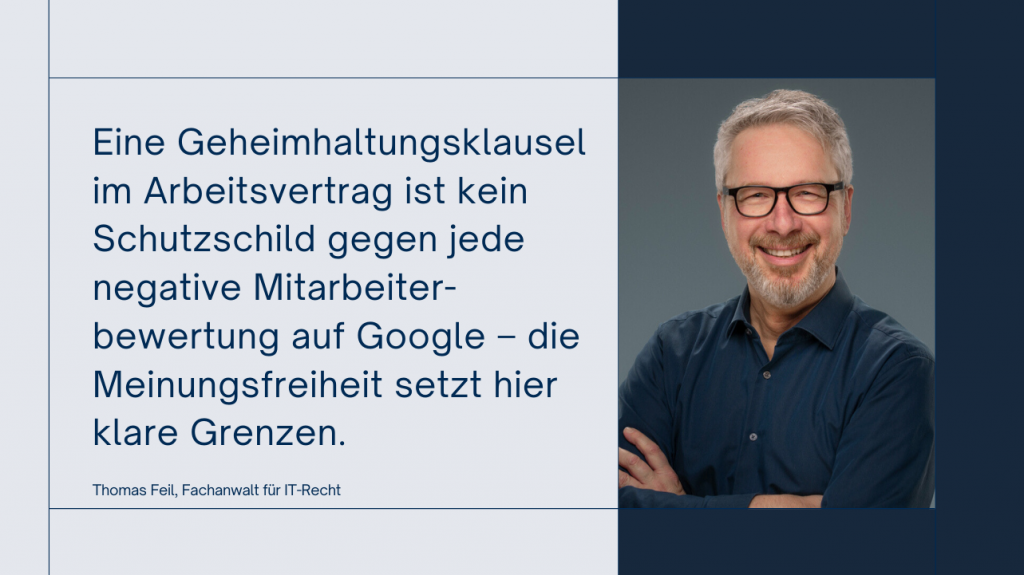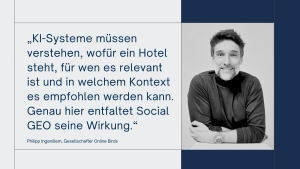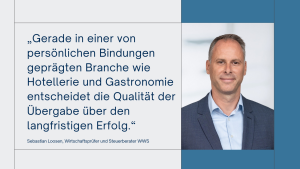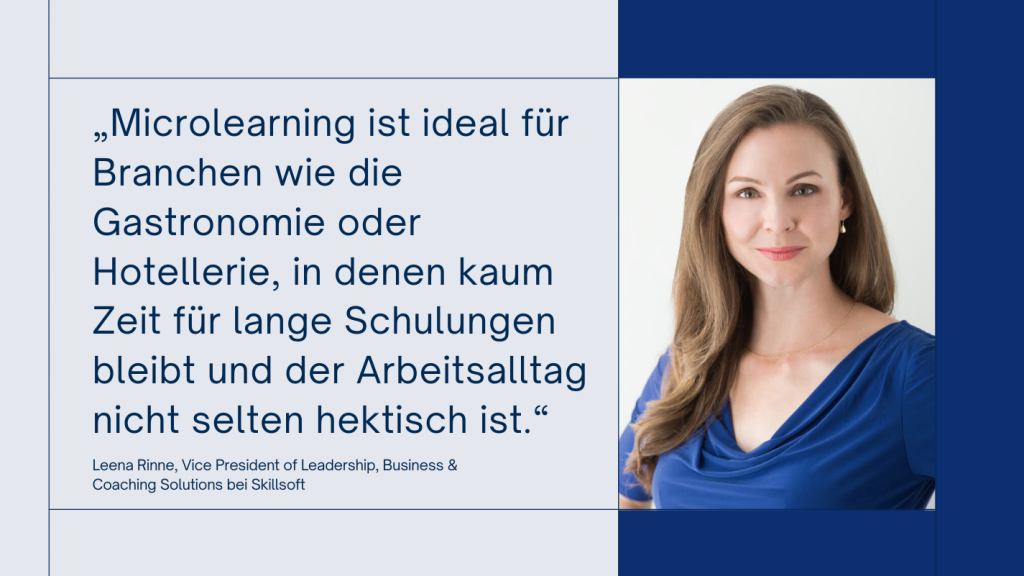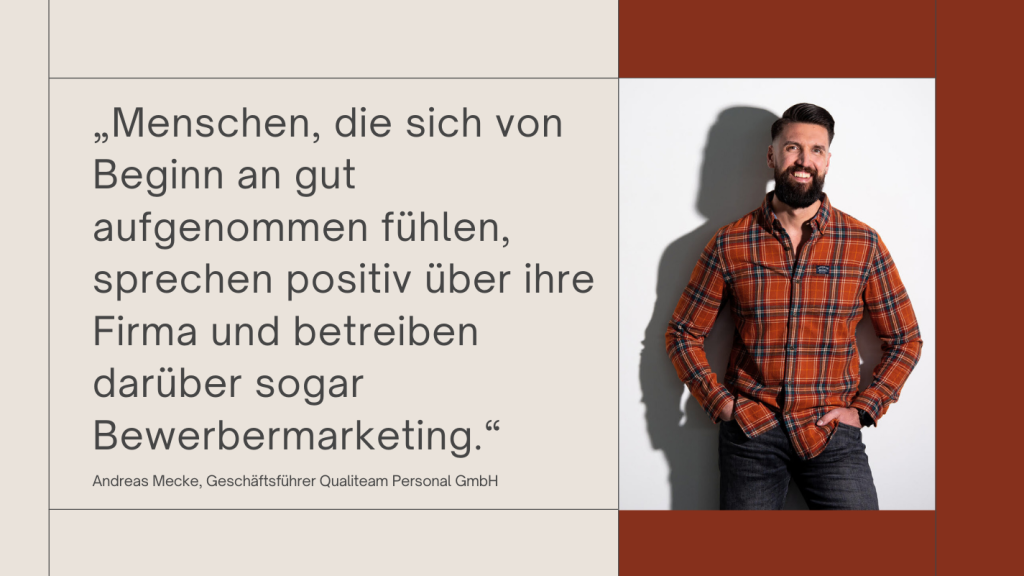Was sind Geheimhaltungsklauseln in Arbeitsverträgen?
Geheimhaltungsklauseln, auch Verschwiegenheitsklauseln genannt, sind vertragliche Vereinbarungen zwischen Hotels und Gastronomiebetriebe sowie deren Mitarbeitenden. Durch sie verpflichtet sich der Arbeitnehmer, bestimmte Informationen, die ihm im Rahmen seines Arbeitsverhältnisses bekannt werden, vertraulich zu behandeln und nicht an Dritte weiterzugeben. Typischerweise zielen solche Klauseln auf den Schutz von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen ab. Dazu können beispielsweise Kalkulationen, Kundenlisten, Marketingstrategien, Rezepturen oder spezifische betriebliche Abläufe gehören. Die Verpflichtung zur Verschwiegenheit kann dabei sowohl während des bestehenden Arbeitsverhältnisses als auch für eine bestimmte Zeit nach dessen Beendigung gelten.
Sind solche Klauseln zur Geheimhaltung generell wirksam?
Grundsätzlich sind Geheimhaltungspflichten im Arbeitsverhältnis anerkannt und auch notwendig, um die berechtigten Interessen des Arbeitgebers zu schützen (§ 241 Abs. 2 BGB Nebenpflichten). Werden sie jedoch als Klauseln in Formulararbeitsverträgen oder Standardverträgen verwendet, unterliegen sie der strengen Kontrolle Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB) nach §§ 305 ff. BGB. Eine Klausel ist unwirksam, wenn sie den Arbeitnehmer entgegen den Geboten von Treu und Glauben unangemessen benachteiligt (§ 307 Abs. 1 S. 1 BGB). Dies ist insbesondere der Fall, wenn die Klausel nicht klar und verständlich ist (Transparenzgebot, § 307 Abs. 1 S. 2 BGB) oder wenn sie inhaltlich zu weit gefasst ist. Eine Klausel, die pauschal alle betrieblichen Vorgänge und Informationen zur Verschwiegenheit erklärt, ist regelmäßig unwirksam, da sie den Arbeitnehmer in seinen Rechten, insbesondere der Meinungsfreiheit, unverhältnismäßig einschränken würde.
Wie könnte eine problematische vs. eine spezifischere Klausel aussehen?
Um die Unterschiede zu verdeutlichen, hier zwei Beispiele:
- Beispiel für eine unwirksame zu weite Klausel: „Der Arbeitnehmer verpflichtet sich, über alle betrieblichen Angelegenheiten, Vorgänge und Informationen jeglicher Art, die ihm während seiner Tätigkeit zur Kenntnis gelangen, sowohl während der Dauer des Arbeitsverhältnisses als auch nach dessen Beendigung Stillschweigen gegenüber jedermann zu bewahren.“
Diese Klausel ist zu unbestimmt und umfassend. Sie würde auch banale oder öffentlich bekannte Informationen einschließen und die Meinungsäußerung über allgemeine Arbeitsbedingungen unzulässig beschränken.
- Beispiel für eine spezifischere wirksame Klausel: „Der Arbeitnehmer verpflichtet sich zur Verschwiegenheit über Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. Dies umfasst insbesondere [konkrete Beispiele wie: detaillierte Kalkulationsgrundlagen, nicht-öffentliche Lieferantenkonditionen, spezifische Rezepturen für Gerichte, Gästedatenbanken]. Die Pflicht gilt während und für einen Zeitraum von zwei Jahren nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Ausgenommen sind Informationen, die offenkundig sind oder deren Weitergabe gesetzlich vorgeschrieben ist.“
Auch eine solche Klausel unterliegt der AGB-Kontrolle, ist aber durch die Konkretisierung eher geeignet, einer rechtlichen Prüfung standzuhalten, sofern sie den Arbeitnehmer nicht unangemessen benachteiligt.
Können Geheimhaltungsklauseln negative Google-Bewertungen durch Mitarbeiter effektiv verhindern?
Hier liegt der Kern der Problematik: Eine allgemeine Geheimhaltungsklausel, selbst wenn sie spezifischer gefasst ist, kann in der Regel nicht dazu verwendet werden, Mitarbeitenden die Äußerung von Meinungen oder die Schilderung wahrer Tatsachen über ihre Arbeitsbedingungen auf öffentlichen Bewertungsplattformen wie Google zu verbieten. Solche Bewertungen fallen grundsätzlich unter die Meinungsfreiheit (Art. 5 Grundgesetz).
Ein Hotel oder Gastronomiebetrieb kann nicht per Vertrag die grundrechtlich geschützte Meinungsäußerung über Aspekte wie Arbeitsklima, Führungsstil, Gehaltsniveau (sofern keine konkreten, geheimen Zahlen genannt werden) oder Einhaltung von Arbeitszeiten unterbinden. Eine Klausel, die dies bezweckt, wäre wegen unangemessener Benachteiligung (§ 307 BGB) und möglicherweise sogar wegen Sittenwidrigkeit (§ 138 BGB) unwirksam. Sie könnte allenfalls dann greifen, wenn der Mitarbeiter in seiner Bewertung nachweislich konkrete, geschützte Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse preisgibt – was bei typischen Google-Bewertungen über Arbeitsbedingungen selten der Fall ist.
Welche Informationen dürfen Mitarbeiter trotz Klausel in Bewertungen preisgeben?
Trotz einer (wirksamen) Geheimhaltungsklausel dürfen Mitarbeiter weiterhin:
- Ihre persönliche Meinung über den Arbeitgeber oder die Arbeitsbedingungen äußern (z. B. „schlechtes Arbeitsklima“, „unfähige Führungskraft“), solange dies nicht in Schmähkritik oder Beleidigung umschlägt.
- Wahre Tatsachen über die Arbeitsbedingungen behaupten (z. B. „Überstunden wurden nicht bezahlt“, „Hygienevorschriften wurden missachtet“). Hier müssen Arbeitnehmer vorsichtig sein, da die Beweislast für die Wahrheit der Behauptung im Streitfall bei der bewertenden Person liegt.
- Informationen über strafbare Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten im Betrieb offenlegen (Whistleblowing), wobei hier besondere gesetzliche Regelungen (wie das Hinweisgeberschutzgesetz) zu beachten sind.
Die Grenze ist dort erreicht, wo die Äußerung unwahre Tatsachenbehauptungen enthält, beleidigend oder verleumderisch ist oder tatsächlich definierte und schützenswerte Geschäftsgeheimnisse offenbart.
Welche rechtlichen Folgen drohen bei einem Verstoß gegen eine wirksame Klausel?
Verstößt ein Mitarbeiter nachweislich gegen eine wirksame Geheimhaltungspflicht, indem er geschützte Informationen preisgibt (was, wie gesagt, bei üblichen Google-Bewertungen selten der Fall ist), können dem Arbeitgeber arbeitsrechtliche Schritte zur Verfügung stehen:
- Abmahnung: Bei weniger schwerwiegenden Verstößen.
- Ordentliche oder außerordentliche Kündigung: Bei erheblichen Pflichtverletzungen, die das Vertrauensverhältnis zerstören.
- Schadensersatzansprüche: Wenn dem Arbeitgeber durch die Pflichtverletzung ein konkreter, bezifferbarer Schaden entstanden ist.
Diese Konsequenzen drohen jedoch in der Regel nicht für eine negative, aber sachliche und wahrheitsgemäße Bewertung der allgemeinen Arbeitssituation.
Was können Arbeitgeber bei negativen Mitarbeiter-Bewertungen auf Google & Co. tun?
Auch wenn Geheimhaltungsklauseln kein Allheilmittel gegen negative Mitarbeiterbewertungen sind, stehen Arbeitgeber rufschädigenden Online-Äußerungen nicht schutzlos gegenüber. Unabhängig von arbeitsvertraglichen Klauseln können Bewertungen rechtlich angreifbar sein, wenn sie:
- Unwahre Tatsachenbehauptungen enthalten.
- Schmähkritik oder Beleidigungen darstellen.
- Gegen die Richtlinien der Bewertungsplattform (z.B. Google) verstoßen (z.B. Interessenkonflikte, Offenlegung privater Informationen).
- Personenbezogene Daten Dritter ohne Einwilligung nennen.
In solchen Fällen besteht die Möglichkeit, die Löschung der Bewertung bei der Plattform zu beantragen oder gerichtlich durchzusetzen.
Die Prüfung der Erfolgsaussichten und die Durchführung eines solchen Löschungsverfahrens erfordern spezifische Rechtskenntnisse im Reputations- und IT-Recht. Betroffene Hoteliers und Gastronomen sollten sich bei rufschädigenden Bewertungen – egal ob von Gästen oder Mitarbeitenden – an einen spezialisierten Rechtsanwalt wenden, um die Handlungsoptionen prüfen und gegebenenfalls die notwendigen Schritte zur Löschung einleiten zu lassen. Viele Kanzleien bieten dazu eine kostenlose Ersteinschätzung an, ob miese Bewertungen erfolgreich gelöscht werden können.